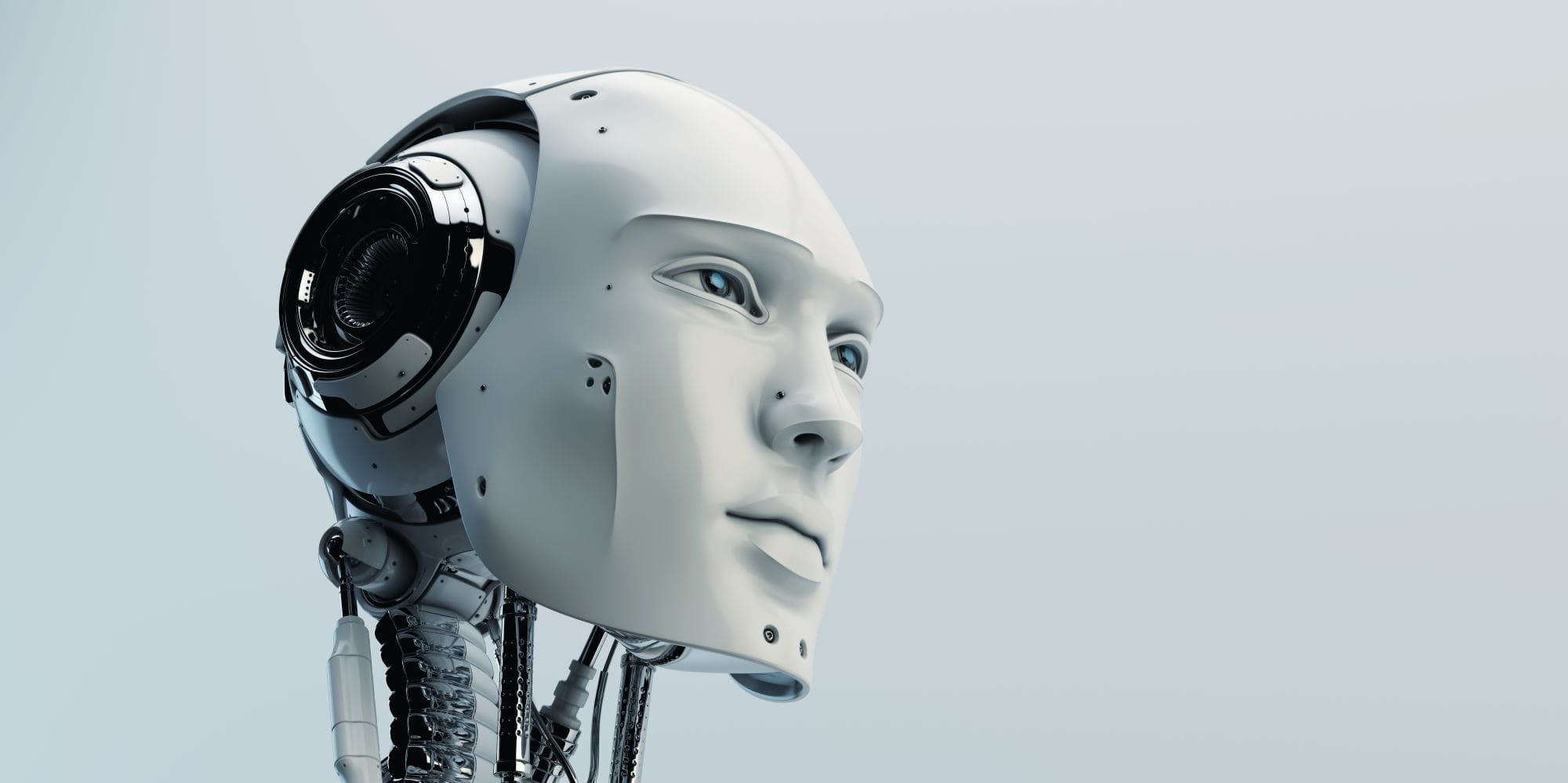
What are the most pressing digital topics?
 Suche
Suche


 Suche
Suche

Am 23. Juli 2025 veröffentlichte der Internationale Gerichtshof (IGH), das höchste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen mit Sitz in Den Haag, sein lange erwartetes Gutachten über die völkerrechtlichen Verpflichtungen von Staaten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Anlass des Gutachtens war ein Ersuchen der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf Grundlage von Art. 65 des IGH-Statuts, wonach der IGH zu klären hatte, ob und in welchem Umfang das Völkerrecht Staaten verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz des Klimasystems zu ergreifen und welche rechtlichen Konsequenzen sich aus einer entsprechenden Pflichtverletzung ergeben können. Das Gutachten, das einstimmig ergangen ist und auf einer breiten Beteiligung von 96 Staaten und 11 internationalen Organisationen beruht, könnte einen Wendepunkt in der völkerrechtlichen Auseinandersetzung mit der Klimakrise markieren. Der IGH bestätigt darin ausdrücklich das Bestehen völkerrechtlicher Schutzpflichten im Hinblick auf den Klimawandel. Im Falle der völkerrechtswidrigen Verletzung dieser Pflichten, etwa durch Unterlassen hinreichender Maßnahmen zum Klimaschutz, könnten Staaten künftig in die Verantwortung genommen werden.


Der Internationale Gerichtshof nimmt als Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen eine besondere Rolle im System der internationalen Gerichtsbarkeit ein. Neben seiner Funktion zur Beilegung zwischenstaatlicher Streitigkeiten kann er von der Staatengemeinschaft auch mit der Erstellung völkerrechtlicher Gutachten betraut werden. Die dem IGH nun vorgelegte, zentrale Leitfrage der Generalversammlung war, ob und inwieweit Staaten nach geltendem Völkerrecht verpflichtet sind, anthropogene Treibhausgasemissionen zu begrenzen und daraus resultierende Schäden an Mensch und Umwelt zu verhindern. Der IGH bejahte diese Frage unmissverständlich. Er stellt klar, dass sowohl (völker-)vertragliche als auch gewohnheitsrechtliche Normen ein Gerüst aus Primärpflichten bilden, das alle Staaten der internationalen Gemeinschaft zum Umweltschutz verpflichtet – ungeachtet von deren Entwicklungsstand oder ihrer historischen Emissionsverantwortung.
Der Gerichtshof hebt insbesondere die drei Klimaabkommen – namentlich das Rahmenübereinkommen der UN über Klimaveränderungen (UNFCCC), das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen – als unmittelbar anwendbares Recht mit daraus folgenden, völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen hervor. Diese betreffen sowohl die Reduktion von Treibhausgasemissionen (Mitigation) als auch die Anpassung an klimabedingte Schäden (Adaption). Zwar begründen die national festgelegten NDCs (Nationally Detemined Contributions) keine unmittelbare Bindungswirkung im Sinne klassischer Verpflichtungen, jedoch scheint der IGH durch den expliziten Verweis auf das Pariser Klimaabkommen, und inzident damit auf das darin verankerte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, in diesen den Ausdruck eines fortschreitenden völkerrechtlichen Konsenses über das erforderliche Ambitionsniveau zu sehen. So betonte auch IGH-Präsident Iwasawa Yuji bei der Vorstellung des Gutachtens eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5° C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit als „primäres Temperaturziel“.
Besonders betont der IGH die sich aus den internationalen Abkommen ergebende Pflicht der Staaten zur Zusammenarbeit, etwa durch Technologietransfers oder Finanzierungshilfen. Zugleich merkt der IGH an, die dort verankerten, geschriebenen Pflichten, würden durch ungeschriebene, völkergewohnheitsrechtliche Pflichten ergänzt. So statuiert der IGH vorwiegend eine Pflicht zur Verhinderung erheblicher, grenzüberschreitender Umweltschäden im Rahmen der durch die Völkerrechtskonstitute gebotenen Kooperation.
Die völkerrechtlichen Klimapflichten, so erkennt der IGH ausdrücklich an, wirken nicht nur im Verhältnis zwischen Staaten, sondern entfalten auch Schutzwirkungen gegenüber Individuen und zukünftigen Generationen. Ähnlich hat bereits das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss vom März 2021 (BVerfGE 157, 30) argumentiert, wonach grundrechtliche Freiheitssicherungen nicht nur gegenwärtig, sondern im Sinne einer intertemporalen Grundrechtswirkung auch mit Blick auf die Zukunft zu gewährleisten sind. Heutigen Generationen dürfe nicht das Recht zugestanden werden, „unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine […] radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde“. Mit vergleichbarer Argumentation erhebt nunmehr auch der IGH den Klimaschutz nicht lediglich zu einer Frage des regulatorischen Umwelt(-völker-)rechts, sondern verleiht ihm durch die Verknüpfung mit den durch die Vereinten Nationen garantierten, fundamentalen Freiheitsrechten auch eine menschenrechtliche Dimension.


Von besonderer Tragweite ist die Aussage des IGH zur völkerrechtlichen Staatenverantwortung. Der Gerichtshof stellt klar, dass die Nichterfüllung der genannten primären Schutzpflichten – etwa die unterlassene Aktualisierung nationaler Klimapläne oder die fehlende Umsetzung effektiver Maßnahmen zur Minderung anthropogener Emissionen – eine „völkerrechtswidrige Handlung“ darstellt, die „die Verantwortung dieses Staates nach sich zieht“. Gemäß den Regeln der Staatenverantwortlichkeit könne sich daraus nach Ansicht des IGH unter Umständen die Pflicht zur „vollen Wiedergutmachung der geschädigten Staaten in Form von Entschädigung“ ergeben. Dabei stellt der IGH heraus: Nicht die Treibhausgasemissionen als solche konstituieren das völkerrechtswidrige Verhalten, sondern die Verletzung der vertraglichen und gewohnheitsrechtlich anerkannten Sorgfalts- und Kooperationspflichten der Staaten. Hierfür gelte das erga omnes Prinzip, wonach völkerrechtliche Verpflichtungen von allen Vertragsstaaten unabhängig von ihrer individuellen Betroffenheit geltend gemacht werden können. Mit anderen Worten: Nach Auffassung des IGH könnte jeder Staat jeden anderen Staat für eine Verletzung der klimaschutzbezogenen, völkerrechtlichen Pflichten in die Verantwortung nehmen.
Zugleich betont der IGH, die Anwendbarkeit des allgemeinen Völkerrechts der Staatenverantwortung werde nicht durch die Klimarahmenverträge als vermeintliches lex specialis ausgeschlossen. Insbesondere das vermehrt vorgetragene Argument, das Pariser Klimaabkommen sei als „soft law“ konzipiert, weil es auf Sanktionsmaßnahmen verzichtet, verfange nach Ansicht des IGH nicht. Vielmehr interpretiert er die in den Vertragswerken vorgesehenen Mechanismen – etwa die regelmäßige Überprüfung der NDCs und das Prinzip der „highest possible ambition“ – als Ausdruck völkerrechtlich verbindlicher Verhaltensmaßstäbe, an denen sich Staaten messen lassen müssen.
Besonders hervorzuheben ist unterdessen die dogmatische Klarstellung zur Zurechnung und Kausalität. Der IGH erkennt die besondere Komplexität des Klimawandels an, der sich gerade nicht auf punktuelle Einzelursachen zurückführen lässt, sondern aus einem multikausalen, kumulativen Wirkungsgefüge, ausgelöst durch transnationale Emissionen, resultiert. Dies führe nach Auffassung der Richter aber nicht dazu, den Kausal- und Zurechnungszusammenhang generell zu verneinen, denn auch bei auf globale Emissionen zurückzuführenden, kollektiven Ursachen könne eine hinreichend direkte und sichere Kausalität im Sinne einer Ursache- und Wirkungsbeziehung bejaht werden. Dabei sei unerheblich, ob mehrere Staaten gemeinsam oder ein Staat allein zur (Klima-)Schädigung beigetragen habe. Jeder einzelne Staat könne für seinen konkreten und wissenschaftlich bestimmbaren Anteil rechtlich zur Verantwortung gezogen werden – ein Argumentationsgang, durch den der IGH die klassische Zurechnungslehre des internationalen Völkerrechts adaptiv weiterentwickelt.


Der Gerichtshof legt ein besonderes Augenmerk auf die menschenrechtliche Dimension des Klimawandels und der Folgen klimabezogener Pflichtverletzungen durch die Staatengemeinschaft. Insoweit erkennt der IGH den Zugang zu einer intakten Umwelt und den Schutz vor klimawandelbedingten Naturkatastrophen als zentrale Voraussetzung für die Ausübung fundamentaler Menschenrechte an. Damit leitet er aus den interstaatlichen Verträgen eine Verpflichtung der Staaten ab, die Umwelt zu schützen und die Ausübung der Menschenrechte zu garantieren. Bemerkenswert erscheint insoweit auch der Ansatz, wonach der Gerichtshof Generationengerechtigkeit als Ausdruck der Vorstellung ansieht, “dass die heutigen Generationen Treuhänder der Menschheit sind, die die Aufgabe haben, menschenwürdige Lebensverhältnisse zu bewahren und an künftige Generationen weiterzugeben“.
In diesem Zusammenhang erkennt der IGH ein eigenständiges Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als normativen Bezugsrahmen an. Auch wenn der Gerichtshof insoweit kein ausdrückliches, subjektives Klagerecht proklamiert, legt er doch nahe, Verstöße gegen Klimaschutzpflichten könnten gegebenenfalls einklagbare Unterlassungs- und Schadensersatzpflichten wegen Menschenrechtsverletzungen im Sinne des nationalen und völkerrechtlichen Staatshaftungsrecht begründen.


Das Gutachten des IGH steht keinesfalls im „luftleeren Raum“. Es reiht sich ein in eine zunehmende Verrechtlichung der Klimakrise auf nationaler wie internationaler Ebene. Besonders instruktiv ist der Vergleich mit der kürzlich ergangenen Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm im Fall Lliuya gegen RWE (Urt. v. 28.05.2025 – 5 U 15/17). In dem medial besonders beachteten Verfahren klagte ein peruanischer Landwirt gegen den deutschen Energiekonzern RWE auf anteilige Mithaftung für die Gefährdung seines Grundstücks in Huaraz durch eine etwaige, zukünftige klimawandelbedingt ausgelöste Gletscherflut. Auch wenn die Klage in Ermangelung des Nachweises einer hinreichenden Gefahrwahrscheinlichkeit letztlich abgewiesen wurde, erkannte das OLG Hamm in einem umfangreichen obiter dictum die grundsätzliche, zivilrechtliche Haftung großer CO2-Emittenten entsprechend des Anteils, den diese zu den weltweiten Emissionen tragen, an (im Fall von RWE 0,38%). Dabei legte das Oberlandesgericht bemerkenswerterweise insbesondere im Hinblick auf die Frage der Kausalität und Zurechnung ähnliche Erwägungen zugrunde, die nun auch der IGH in seinem Gutachten paradigmatisch heranzieht. Insbesondere führe nach Auffassung des OLG Hamm auch die Multikausalität und der absolut gesehen geringe Anteil am weltweiten Emissionsausstoß nicht zu einer Enthaftung des Emittenten aus Gründen mangelnder Zurechenbarkeit.
Vergleichbare Entwicklungen lassen sich weltweit ausmachen. So markieren etwa der bereits erwähnte Klima-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das niederländische Urgenda-Urteil, das Verfahren Milieudefensie v. Shell oder die Klimaseniorinnen-Entscheidung des EGMR eine Rechtsprechungslinie in der Climate Litigation, die durch die menschen- und völkerrechtliche Dimension des IGH-Gutachtens weiter konsolidiert wird.


Unmittelbare, rechtliche Bindungswirkung kann das Gutachten des IGH zwar nicht entfalten, dennoch hat es vor allem für stark vom Klimawandel betroffene Nationen – wie etwa den Inselstaat Vanuatu – sowie Umweltaktivist*innen und NGOs eine nicht zu unterschätzende Signalwirkung. Der Gerichtshof bekräftigt nicht nur die aus multilateralen Übereinkommen und dem Völkergewohnheitsrecht abgeleiteten Schutzpflichten der Staaten gegenüber dem globalen Klimasystem, sondern erkennt auch die individualrechtliche Dimension des Klimaschutzes ausdrücklich an. Auch wenn der IGH sich dabei nicht aus dem Rahmen der bekannten völkerrechtlichen Strukturen heraus bewegt oder gar ein neues Haftungsregime begründet, steht zu erwarten, dass sich private Kläger, NGOs wie letztlich auch die zur Entscheidung angerufenen Gerichte künftig verstärkt auf die vom IGH entwickelten, völkerrechtlichen Argumente stützen werden. Das Gutachten kann insoweit als autoritative Auslegungshilfe in der Climate Litigation aufgefasst werden – ein Verfahrensbereich, dessen Konzept durch die Feststellungen des Gutachtens weiter an Kontur und Schärfe gewinnt.
Zwar kann das Unterlassen effektiver Klimaschutzmaßnahmen nach Auffassung des IGH einen konkreten Verstoß gegen das Völkerrecht und fundamentale Menschenrechte begründen. Hierdurch hat der Gerichtshof seine grundsätzliche Offenheit gegenüber möglichen Klagerechten auch nicht-staatlicher Akteure zum Ausdruck gebracht – auch, wenn vorerst offenbleibt, unter welchen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen eine solche Verantwortlichkeit im Einzelfall geltend gemacht werden kann. Insoweit schlägt der IGH in seinen Ausführungen einen vermittelnden Kurs ein: Er betont die völkerrechtliche Relevanz staatlichen Klimahandelns, ohne das zwischenstaatliche Gefüge oder den klassischen Rechtsdurchsetzungsmechanismus grundlegend in Frage zu stellen.
Angesichts der normativen Orientierungskraft, die die Feststellungen des IGH entfalten, müssen sich auch private Akteure auf die (mittelbaren) Auswirkungen des Gutachtens einstellen, etwa durch stärkere Regulierung CO2-intensiver Geschäftszweige.
Das Gutachten verdeutlicht: Klimaschutz ist längst nicht mehr nur politische Aufgabe – er ist völkerrechtlich kodifizierte Erwartung mit zunehmendem juristischen Durchsetzungsanspruch.
Verfasst von Julius Fabian Stehl, LL.M., und Yannik Pilot.