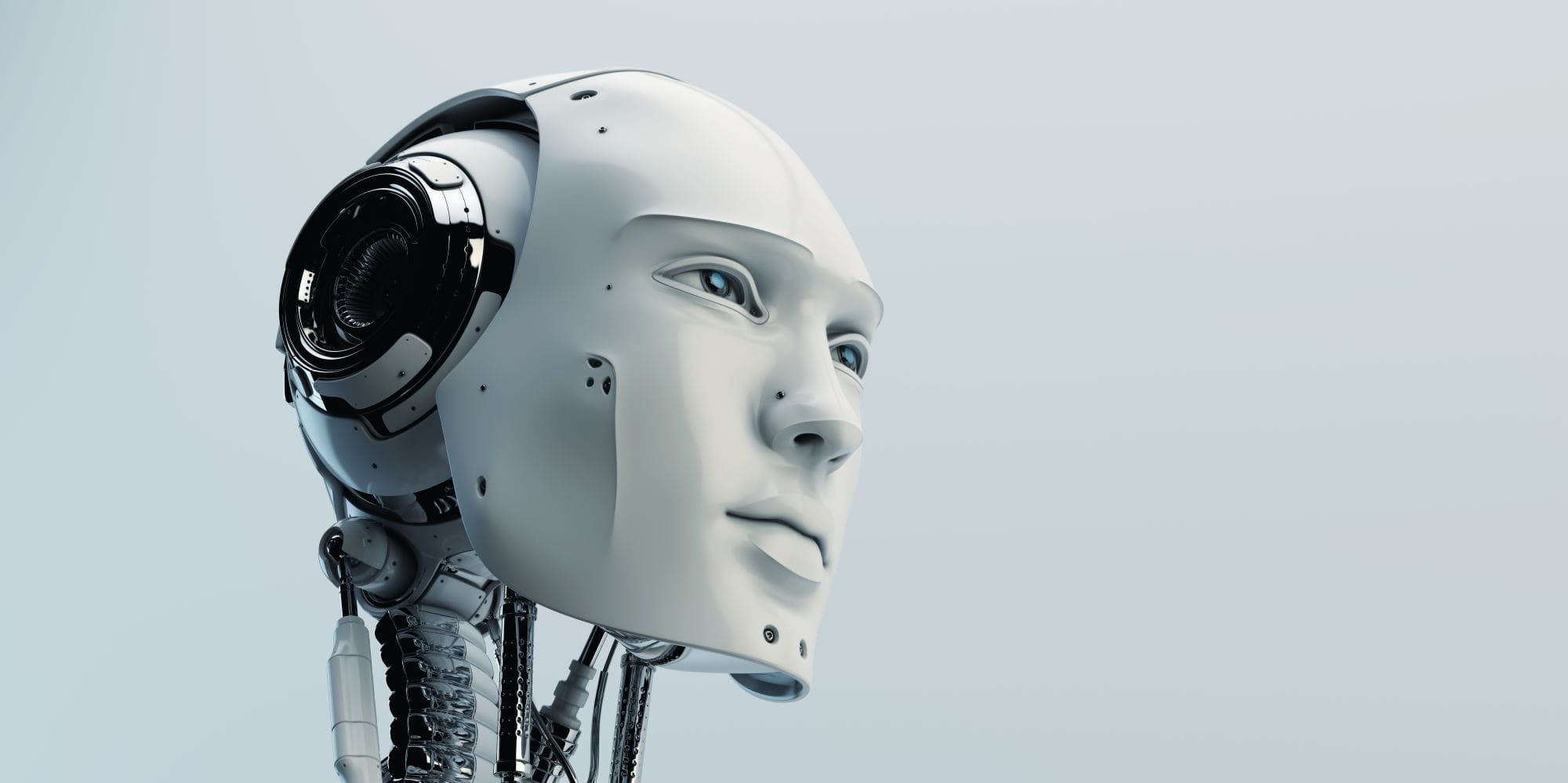
What are the most pressing digital topics?
 Suche
Suche


 Suche
Suche

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse („PUA“) sind ein zentrales Kontrollelement. Sie dienen dazu, Vorwürfe zu politischen Missständen, Fehlverhalten der politischen Entscheidungsträger und möglichen Gesetzesverstößen aufzuklären. Dabei bergen PUA erhebliche Risiken für die betroffenen Akteure. Dies zeigt sich exemplarisch am Fall des ehemaligen Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, der im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut in den Fokus parlamentarischer Untersuchungen geriet und nunmehr wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss von der Berliner Staatsanwaltschaft angeklagt wurde. Die Risiken sind jedoch nicht auf politische Akteure beschränkt. Immer wieder geraten auch Unternehmen und Unternehmensvertreter in den Fokus eines PUA. Auch sie sind dann strafrechtlichen Risiken sowie Reputationsrisiken ausgesetzt. Dem PUA kommt in diesen Fällen – neben dem teilweise zusätzlich geführten Wirtschaftsstrafverfahren durch Ermittlungsbehörden – eine eigenständige Rolle zu.
Ein PUA verfügt über weitreichende Befugnisse. Diese finden ihre gesetzliche Grundlage in Art. 44 GG sowie in dem Untersuchungsausschussgesetz (sog. PUAG). Sie sind in weiten Teilen mit denen der Strafverfolgungsbehörden vergleichbar.
Zu den zentralen Befugnissen eines PUA gehört unter anderem die Vernehmung von Zeugen (§ 24 PUAG). Zeugen, zu denen beispielsweise auch Führungskräfte von Unternehmen gehören können, sind verpflichtet, vor dem Ausschuss zu erscheinen und auszusagen. Insbesondere die Zeugenaussage vor dem PUA birgt aufgrund der geltenden strafbewehrten „Wahrheitspflicht“ strafrechtliche Risiken (Aussagedelikte).
Der PUA ist zudem gemäß §§ 29, 30 PUAG berechtigt, die Herausgabe der Beweismittel, wie zum Beispiel Akten, durch Private zu verlangen. Wird die Herausgabe verweigert, so kann der PUA nach § 29 Abs. 2 PUAG ein Ordnungsgeld festlegen, um die Herausgabe zu erzwingen. Darüber hinaus kann ein PUA zur Durchsetzung seines Herausgabeverlangens den Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses beantragen.
Das Untersuchungsausschussverfahren findet mit der Berichterstattung gemäß § 33 PUAG seinen Abschluss. Der sog. Abschlussbericht informiert den Bundestag über die Ergebnisse des PUA. Der Abschlussbericht ist grundsätzlich darauf angelegt, politische Verantwortlichkeiten zu ermitteln. Hierfür enthält er eine Beschreibung des Sachverhalts, wie er sich aus Sicht des PUA darstellt. Es ist ferner vermehrt zu beobachten, dass Abschlussberichte neben Feststellungen zum Sachverhalt auch rechtliche Bewertungen beinhalten, die für (mittelbar) betroffene Unternehmen eine hohe Relevanz aufweisen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Abschlussberichte im Grundsatz als Bundestagsdrucksache veröffentlicht werden und von der Öffentlichkeit eingesehen werden können. Hinzu kommt, dass sämtliche Akteure, wie beispielsweise Behörden, Unternehmen und andere, anders als in veröffentlichten Urteilen, mit Klarnamen genannt werden.
Zwar kommt den Berichten des PUA keine Feststellungs- bzw. Bindungswirkung zu. Staatliche Gerichte dürfen die Feststellungen eines PUA insofern nicht übernehmen, sondern müssen eigene Feststellungen treffen (Art. 44 Abs. 4 S. 2 GG). Es ist den Staatsanwaltschaften und Gerichten jedoch gestattet, in die Protokolle der Zeugenvernehmungen Einsicht zu nehmen. Die Ergebnisse des PUA können daher neben der nicht zu unterschätzenden „medialen Vorverurteilung“ auch die Grundlage für Feststellungen in einem parallel geführten Strafverfahren bilden.
Trotz dieser erheblichen Risiken stehen betroffenen Unternehmen regelmäßig keine effektiven Rechtsschutzmöglichkeiten zu, um die im Abschlussbericht festgehaltenen Ergebnisse des PUA gerichtlich überprüfen zu lassen. Unternehmen, die durch die Veröffentlichung des Abschlussberichtes in ihren Rechten erheblich beeinträchtigt werden können, ist nach den Regelungen des PUAG vor Abschluss des Untersuchungsverfahrens lediglich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme zu den sie betreffenden Ausführungen im Entwurf des Abschlussberichtes muss grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen stattfinden (§ 32 Abs. 1 PUAG). Die sie betreffenden Passagen des Abschlussberichts werden den Betroffenen hierfür zur Stellungnahme vorab zur Verfügung gestellt. Der wesentliche Inhalt der Stellungnahme des Betroffenen ist dann in den Abschlussbericht aufzunehmen (§ 32 Abs. 2 PUAG).
Folgende Maßnahmen helfen, Reputations- und strafrechtliche Risiken im Zusammenhang mit einem PUA zu reduzieren:
Verfasst von Désirée Maier, Dr. Sebastian Gräler und Dr. Noel Schröder.