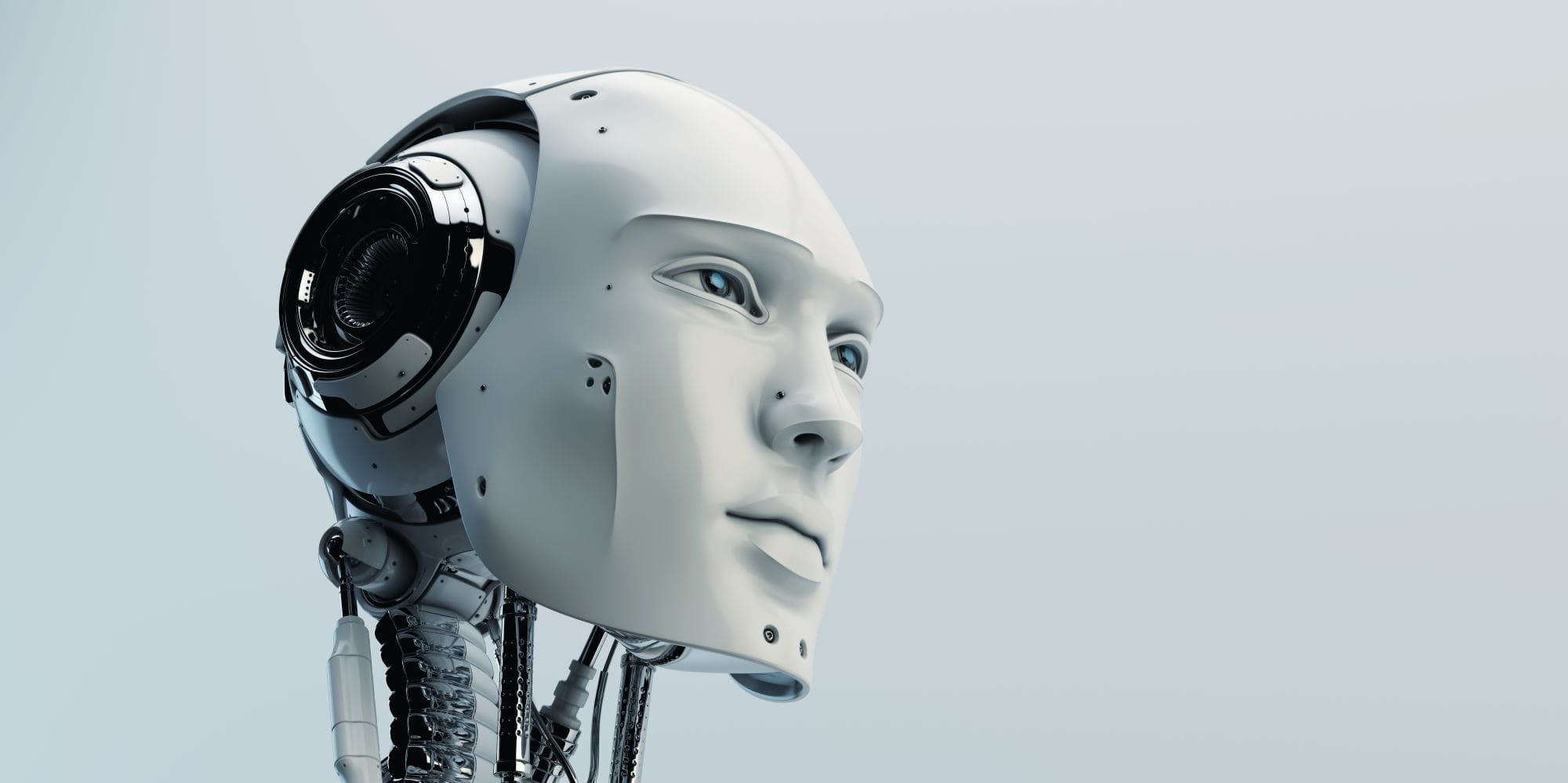
What are the most pressing digital topics?
 Suche
Suche


 Suche
Suche

Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Trend – sie wird zum entscheidenden Faktor für die Immobilienbranche. Mit dem Green Lease 2.0 hat die Arbeitsgruppe des Zentralen Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ein innovatives Regelwerk geschaffen, das ökologische, soziale und unternehmensethische Ziele in den Mittelpunkt rückt. Doch wie profitieren Vermieter und Mieter konkret davon und welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Wie läuft es in der Praxis? In diesem Beitrag erfahren Sie, warum der Green Lease 2.0 als Meilenstein für nachhaltige Mietverhältnisse gilt und worauf es bei der praktischen Umsetzung wirklich ankommt.
Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern prägt zunehmend auch den Immobiliensektor. Mit der Veröffentlichung des Green Lease 2.0 am 7. März 2024 hat der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) einen wichtigen Meilenstein gesetzt, um Mietverträge an die aktuellen Anforderungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) anzupassen. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff „Green Lease 2.0“ und wie wird er in der Praxis angenommen?
Ein „Green Lease“ ist ein Mietvertrag, der über die klassischen Regelungen hinaus Nachhaltigkeitsaspekte integriert. Ziel ist es, sowohl Vermieter als auch Mieter zu umweltbewusstem Handeln zu verpflichten und gemeinsam Ressourcen zu schonen. Die Version 2.0 des Green Lease geht noch einen Schritt weiter: Sie berücksichtigt nicht nur Umweltaspekte (Environmental), sondern auch soziale (Social) und unternehmensethische (Governance) Kriterien – kurz: ESG. Damit orientiert sich der Green Lease 2.0 an den Vorgaben der EU-Taxonomie-Verordnung, die einheitliche Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten festlegt (vgl. Verordnung (EU) 2020/852).
Ein zentrales Element des Green Lease 2.0 ist der Austausch von Verbrauchsdaten und die Einführung eines Energie-Monitorings. Ziel ist es, CO₂-Emissionen bei der Nutzung von Immobilien messbar zu reduzieren. Je nach Ausgestaltung der konkreten Vertragsklauseln verpflichten (oder bemühen) sich die Parteien, relevante Daten zu teilen und gemeinsam Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu entwickeln und umzusetzen. Dies kann beispielsweise durch die Installation von Smart-Metern oder die Nutzung erneuerbarer Energien erfolgen. Ein weiteres und nach wie vor zentrales Element ist die Möglichkeit, die Bewirtschaftung unter Berücksichtigung ökologischer Standards zu erbringen, auch wenn dies im Einzelfall etwas teurer sein sollte.
Beispiel: Ein Bürogebäude, dessen Mietparteien sich im Rahmen eines Green Lease 2.0 verpflichten, regelmäßig Energieverbräuche zu erfassen und gemeinsam Maßnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs zu entwickeln.
Zwanzig Monate nach der Einführung des Green Lease 2.0 hat der ZIA eine umfassende Mitgliederbefragung zur praktischen Umsetzung des neuen Regelwerks durchgeführt. Die Resultate dieser Erhebung zeichnen ein erfreuliches Bild: Rund 80 % der befragten Unternehmen greifen bereits auf die vom ZIA entwickelten Regelungsempfehlungen zurück, und 84 % der Teilnehmenden setzen die darin enthaltenen nachhaltigen Praktiken aktiv um. Die Befragten betonen die Bedeutung gemeinsamer Nachhaltigkeitsstrategien und die Wichtigkeit der aktiven Mitwirkung beider Parteien. Die Möglichkeit dadurch eine umweltfreundlichere Bewirtschaftung zu erreichen, wird von den Befragten als ein zentraler Vorteil des Green Lease 2.0 gesehen. Erreichte Kosteneinsparungen kämen nicht nur den Vermietern, sondern auch den Mietern zugute und fördern neben einer höheren Zufriedenheit der Parteien auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne der Nachhaltigkeit.
Gleichwohl zeigen die Umfrageergebnisse, dass die Implementierung des Green Lease 2.0 nicht frei von Herausforderungen ist. Insbesondere auf Mieterseite besteht nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung, die erweiterten Nachhaltigkeitsbestimmungen vollständig zu übernehmen – und das, obwohl die Vorteile grundsätzlich anerkannt werden. Als wesentliche Hürde wird häufig die Anforderung an den Datenschutz genannt: Viele Akteure empfinden die aktuellen Datenschutzstandards als zu restriktiv. Der Wunsch nach einer möglichst schlanken und praxisnahen gesetzlichen Regelung ist daher deutlich spürbar, um die Flexibilität bei der Vertragsgestaltung zu erhalten und die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen, wie z.B. den Austausch von Verbrauchsdaten, zu erleichtern. Der Datenaustausch wurde von den Befragten ausdrücklich als wertvolle Unterstützung bei der Bewertung der Energieeffizienz einer Immobilie genannt.
Ein weiteres zentrales Ergebnis der Befragung ist der klare Appell an die Politik und die Branche, einen einheitlichen europäischen Standard für einen Green Lease zu schaffen. Nur so können Wettbewerbsverzerrungen vermieden und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Immobiliensektor zur Reduktion von CO2-Immissionen gestärkt werden. Der fortlaufende Dialog und der Austausch mit allen relevanten Stakeholdern bleiben daher unerlässlich, um die Vertragsmuster kontinuierlich weiterzuentwickeln und optimal an die Bedürfnisse der Praxis anzupassen.
Mit der Veröffentlichung einer englischen Fassung des Green Lease 2.0 hat der ZIA einen weiteren Schritt zur Internationalisierung getan. Dies erleichtert die Integration internationaler Beteiligter und die Anwendung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten.
Der Green Lease 2.0 ist ein wichtiger Baustein für mehr Nachhaltigkeit im Immobiliensektor. Er bietet klare Vorteile für Vermieter und Mieter, insbesondere durch Kosteneinsparungen, die in Folge von Energieeinsparmaßnahmen entstehen können und die Erfüllung regulatorischer Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Reportingpflichten.
Auch wenn derzeit viel über die Vereinfachung bzw. Abschaffung von Reportingstandards und Umweltzielen diskutiert wird, bleiben die Umweltrisiken. Diese werden zukünftig bei jeder Finanzierungsentscheidung geprüft werden. Der Green Lease leistet einen Beitrag dazu, dass Gebäude nachhaltig bewirtschaftet werden können und das Ziel der CO2-Neutralität erreichbar ist.
Um Rechtssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, sollte die Entwicklung eines europäischen Green Lease Standards weiter vorangetrieben werden.
Verfasst von Sabine Reimann und Kerstin Schoening.
Quellenangabe