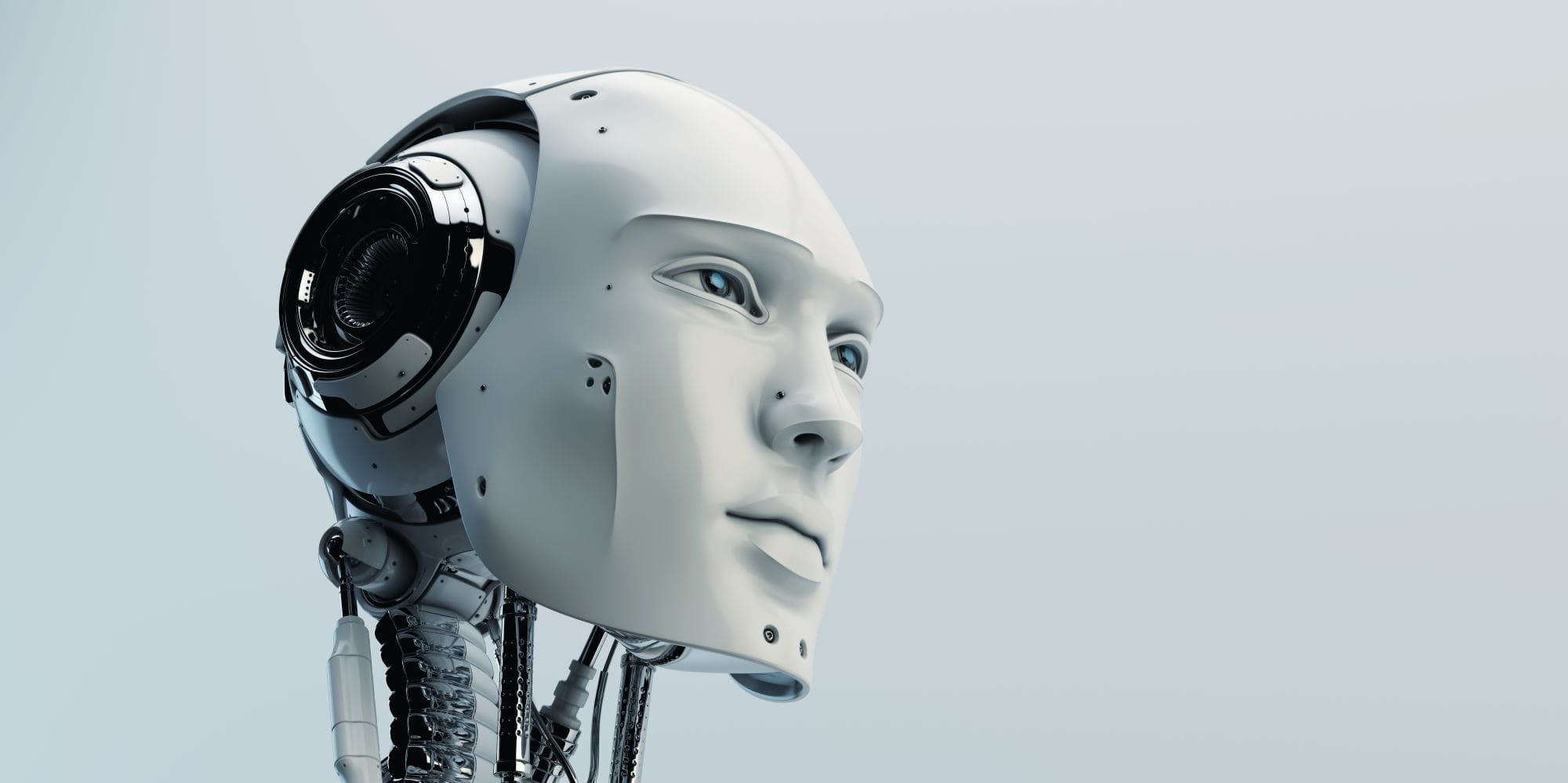
What are the most pressing digital topics?
 Suche
Suche


 Suche
Suche

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Urteil klargestellt, dass Eigentümer von Gebäuden unter bestimmten Umständen Fernwärmeanlagen eines Versorgungsunternehmens auch dann dulden müssen, wenn diese nicht mehr genutzt werden. Doch wann genau besteht eine solche Duldungspflicht – und welche Rolle spielen Altverträge und Grunddienstbarkeiten? Das Urteil wirft spannende Fragen zur rechtlichen Einordnung technischer Infrastruktur in Bestandsimmobilien auf, die auch für Photovoltaikanlagen und Wallboxen relevant sind. Erfahren Sie im vollständigen Artikel, worauf Eigentümer jetzt besonders achten sollten und wie Sie rechtliche Fallstricke vermeiden können.
In einer aktuellen Entscheidung hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit einer praxisrelevanten Frage für Immobilieneigentümer beschäftigt: Müssen Eigentümer von Gebäuden Fernwärmeeinrichtungen eines Versorgungsunternehmens in ihren Immobilien dulden – auch dann, wenn diese Anlagen nicht mehr in Betrieb sind?
Ausgangspunkt war ein notarieller Kaufvertrag aus dem Jahr 1994. Damals verkaufte ein Energieversorger seinen gesamten Geschäftsbereich „Fernwärmeversorgung“ samt Grundstücken und Infrastruktur an ein anderes Unternehmen. Im Vertrag wurde festgelegt, dass künftige Mieter ihre Wärme ausschließlich vom Käufer beziehen sollten. In den auf dem Grundstück befindlichen Fabrik- und Verwaltungsgebäuden wurden Teile des Fernwärmenetzes installiert, darunter innenliegende Rohre, Fernwärmeübergabestationen und Wärmetauscher.
Bis Ende 2014 versorgte die Beklagte die Gebäude mit Wärme, stellte den Betrieb dann jedoch ein. Die Eigentümerin verlangte daraufhin die Entfernung der Anlagen und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Während das Landgericht Magdeburg die Klage abwies, gab das Oberlandesgericht Naumburg der Eigentümerin Recht. Der BGH hob diese Entscheidung nun teilweise auf und verwies den Fall zurück.
Der BGH stellte klar: Die Fernwärmeeinrichtungen stellen zwar eine Eigentumsbeeinträchtigung dar, gehören aber als sogenannte Scheinbestandteile (§ 95 Abs. 2 BGB) weiterhin dem Versorgungsunternehmen. Ob die Eigentümerin die Anlagen dulden muss, hängt jedoch von den vertraglichen Vereinbarungen und etwaigen Grunddienstbarkeiten ab. Insbesondere ist zu prüfen, ob sich aus dem damaligen Kaufvertrag oder aus einem Leitungsrecht eine Duldungspflicht ergibt oder ob solche Pflichten durch spätere Vereinbarungen erloschen sind.
Das Urteil unterstreicht, wie wichtig es ist, die rechtliche Einordnung technischer Infrastrukturen in Bestandsimmobilien sorgfältig zu prüfen. Gerade in älteren Gebäuden finden sich häufig noch Anlagen ehemaliger Energieversorger, die nicht automatisch Bestandteil des Grundstücks und mitunter auch nicht durch Dienstbarkeiten gesichert sind.
Für Eigentümer bedeutet das: Solche Anlagen können zwar eine Beeinträchtigung des Eigentums darstellen, müssen aber unter Umständen geduldet werden, wenn entsprechende vertragliche Verpflichtungen oder dingliche Rechte (z. B. Grunddienstbarkeiten) bestehen. Ob und in welchem Umfang eine Duldungspflicht besteht, hängt immer vom Einzelfall und den zugrundeliegenden Verträgen ab. Grundsätzlich besteht zwar ein Löschungsanspruch auch bei Dienstbarkeiten immer dann, wenn der Berechtigte das Recht dauerhaft nicht mehr nutzt. Allerdings lassen viele Dienstbarkeiten auch die Überlassung an Dritte zu, was auch im Rahmen gemeindlicher Wärmeplanung für bestehende Fernwärmeleitungen Relevanz bekommen kann.
Auch bei Photovoltaikanlagen, damit verbundenen Energiespeichern und Wallboxen, stellt sich die Frage, ob diese als wesentliche Bestandteile des Grundstücks gelten oder als sogenannte Scheinbestandteile sonderrechtsfähig bleiben. Entscheidend sind die Art der Verbindung mit dem Gebäude, die Dauerhaftigkeit und der wirtschaftliche Zweck. Bei Photovoltaikanlagen mit Energiespeicher zur autarken Versorgung eines Grundstückes spricht viel für einen wesentlichen Bestandteil (§ 94 BGB). Sind Anlagen gar Teil des Daches selbst, gilt dies ebenso. Bei sogenannten Aufdachanlagen, die nur vorübergehend installiert sind, insbesondere im Rahmen eines Miet- oder Pachtverhältnisses, sind sie als Scheinbestandteile gemäß § 95 BGB zu klassifizieren und bleiben sonderrechtsfähig. Gleiches gilt für Wallboxen, die eher Scheinbestandteile sind, weil sie leicht zu demontieren und für die Funktionsfähigkeit einer Immobilie in der Regel untergeordnet bzw. unbeachtlich sind.
Die sachenrechtliche Einordnung ist insbesondere bei Eigentumsübertragungen, Insolvenzverfahren oder bei der Bestellung und Verwertung von Sicherheiten von großer Bedeutung und sollte stets rechtlich geprüft und eindeutig geregelt werden.
Das aktuelle BGH-Urteil ist ein wichtiger Hinweis für alle Immobilieneigentümer: Technische Infrastruktur in Gebäuden gehört nicht automatisch zum Gebäude bzw. Grundstück und damit auch nicht immer dem Grundstückseigentümer. Wer Bestandsimmobilien erwirbt oder verwaltet, sollte Altverträge, Grunddienstbarkeiten und Eigentumsverhältnisse an Leitungen und Anlagen sorgfältig prüfen. Nur so lassen sich spätere Überraschungen und rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden.
Verfasst von Sabine Reimann und Kerstin Schoening.
Quellenangabe